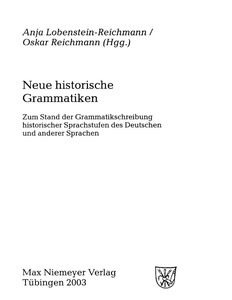Suche
Anzeige der Dokumente 1-10 von 33
Teil eines Buches

 Das "einfachste" mittelhochdeutsche Gedicht. Wörterbuchgerechte Verneuhochdeutschung und textgerechte Übersetzung
Das "einfachste" mittelhochdeutsche Gedicht. Wörterbuchgerechte Verneuhochdeutschung und textgerechte Übersetzung
(Lehrstuhl für Deutsche Sprache und Literatur der Loránd-Eötvös-Universität, 1989)
Teil eines Buches

 Satzbaupläne als Zeichen: die semantischen Rollen des Deutschen in Theorie und Praxis
Satzbaupläne als Zeichen: die semantischen Rollen des Deutschen in Theorie und Praxis
(De Gruyter, 2021)
Thema des Beitrags sind Satzbaupläne als komplexe syntaktisch-semantische Sprachzeichen. An der Schnittstelle von Valenztheorie (GTA 2017; Ágel 2015, 2000) und Konstruktionsgrammatik (Goldberg 1995; Schneider 2014) werden Satzbaupläne nicht als formale Zeichen wie in traditionellen Satzbauplankonzepten, sondern als abstrakte Zeichen mit einer Formseite (Satzglieder) und einer Inhaltsseite (signifikativ-semantische Rollen) aufgefasst (GTA 2017; Höllein 2019). Die Satzbauplanzeichen sind dabei vollständig abstrakte ...
Teil eines Buches
 Phraseologismus als (valenz)syntaktischer Normalfall
Phraseologismus als (valenz)syntaktischer Normalfall
(De Gruyter, 2004)
Mehr oder weniger feste Wortverbindungen stellen keine Sonder-, sondern vielmehr Normalfälle sprachlicher Zeichenbildung dar. In krassem Gegensatz zum sprachlichen Normalstatus steht allerdings ihr linguistischer Reststatus in der traditionellen Theoriebildung. Wenn man zum Minimalkriterium deskriptiver Adäquatheit macht, gewöhnliche sprachliche Phänomene mit gewöhnlichen Mitteln einer linguistischen Theorie zu beschreiben, so ergibt sich aus der Statusspannung eine anspruchsvolle Aufgabe für künftige Theorien. ...
Teil eines Buches
 Grammatik und Kulturgeschichte. Die raison graphique am Beispiel der Epistemik
Grammatik und Kulturgeschichte. Die raison graphique am Beispiel der Epistemik
(De Gruyter, 1999)
Indem sie in ihrem Begleitbrief zur Tagungseinladung zwei mögliche Lesarten des Themas „Grammatik und Kulturgeschichte“ formulieren, deuten Andreas Gardt, Ulrike Haß-Zumkehr und Thorsten Roelcke sogleich eine Fülle von theoretischen und methodologischen Problemen an: Wenn die Grammatikographie keine positivistische „Faktenwissenschaft“ ist, die die grammatischen Spezifika einfach vorfindet und dann hinschreibt, sondern wenn sie ihren Gegenstand konstruiert, dann müssen diese Konstruktionen nach irgendwelchen Kriterien ...
Teil eines Buches

 Dem Jubilar seine Festschrift: Ein typologisches Kuckucksei in der deutschen Substantivgruppe
Dem Jubilar seine Festschrift: Ein typologisches Kuckucksei in der deutschen Substantivgruppe
(ELTE, Germanistisches Institut, 1993)
Der deutsche Konstruktionstyp „dem Jubilar seine Festschrift“ (Paradebeispiel: dem Vater sin Haus), d.h. die Nominalphrase (NP) mit adnominalem possessivem Dativ (vgl. Schmid 1988, 138ff. und 246ff. und für vergleichbare Konstruktionen in anderen Sprachen Ramat 1986), hat es schwer. Er ist aus den Grammatiken der modernen deutschen Standardsprache entweder gänzlich verbannt oder fristet ein „Paarzeilendasein“, woran der meist erhobene Zeigefinger der älteren Grammatikographie sicher nicht ganz unschuldig ist.
Teil eines Buches
 Polylexikalität oder am Anfang waren mindestens zwei Wörter. Über eine Grundfrage (nicht nur) der Phraseologie
Polylexikalität oder am Anfang waren mindestens zwei Wörter. Über eine Grundfrage (nicht nur) der Phraseologie
(Peter Lang, 2004)
Nach Regina Hessky (2000: 2102) ist die Phraseologie „zweifellos eigenständig von ihrem Objektbereich her gesehen, insofern sie ein Segment des Lexikons untersucht, das sich von dessen übrigen Teil durch relevante Merkmale unterscheidet.“ Trotz der zweifelsfreien Eigenständigkeit des phraseologischen Objekts sei man sich jedoch über die Frage, ob die Phraseologie eine autonome linguistische Teildisziplin oder einen Teil der Lexikologie darstellt, nicht einig (edb.). […] Ich denke, dass die methodologisch-theoretischen ...
Teil eines Buches
 Markierte Vorfeldbesetzung im Neuhochdeutschen. Zur Grammatikalisierung einer neuen Vorfeldstruktur
Markierte Vorfeldbesetzung im Neuhochdeutschen. Zur Grammatikalisierung einer neuen Vorfeldstruktur
(Weidler Buchverlag, 2020)
Die Untersuchung der markierten Vorfeldbesetzung erfreut sich seit längerer Zeit einer gewissen Beliebtheit. Dies hat vor allem theoretische Gründe: Als Defaultfall gilt die Besetzung des Vorfelds durch eine Konstituente / ein Satzglied, weshalb sich für jede Grammatiktheorie bzw. jeden Grammatikansatz die Frage stellt, wie man mit ,abweichenden‘ Belegen / Beispielen umgehen soll. Für sprachhistorische Arbeiten stellt sich zusätzlich die Frage, wie sich das „Vorfeld als Baustelle des Deutschen“ mit oder ohne mehrfache ...
Teil eines Buches
 Brisante Gegenstände
Brisante Gegenstände
(Narr Francke Attempto, 2015)
Die empirische und theoretische Schnittmenge von Valenztheorie (im Folgenden: VT) und Konstruktionsgrammatik (KxG) sind grammatische Grundstrukturen, die in der VT Valenz(realisierungs)muster, Kasusrahmen, Satzmodelle oder Satzbaupläne (z.B. Ickler 1990; Welke 1994; Vuillaume 2003; Ágel 2004), in der KxG Argumentstrukturen bzw. Argumentstrukturmuster (z.B. Goldberg 1995; Engelberg/König/Proost/Winkler 2011) genannt werden. Obwohl die Herangehensweisen der beiden Theorien bekanntlich unterschiedlich sind (projektionistisch ...
Teil eines Buches
 Prinzipien der Grammatik
Prinzipien der Grammatik
(Max Niemeyer Verlag, 2003)
Als künftiger Autor der „Neuhochdeutschen Grammatik" in der „Sammlung kurzer Grammatiken germanischer Dialekte" ist man doppelt in die Zange genommen. Denn einerseits hat man die Verpflichtung und auch den Willen, eine ehrwürdige Tradition historischer Grammatikschreibung würdig fortzusetzen. Andererseits muss man auch den theoretischen Anforderungen genügen, die an Gegenwartsgrammatiken gestellt werden. Schließlich mündet ja die eigene historische Beschreibung unmittelbar in die Beschreibung der Gegenwartssprache. ...
Teil eines Buches
 Das Wort – Sprech- und/oder Schreibzeichen?
Das Wort – Sprech- und/oder Schreibzeichen?
(Max Niemeyer Verlag, 2002)
Irgendwann Mitte der 90er Jahre hat Oskar Reichmann in einer Heidelberger Vorlesung (sinngemäß) Folgendes gesagt: „Ohne empirische Fundierung ist die lexikografische Praxis, die Konjunktion aber und die Abtönungspartikel aber in demselben Wortartikel abzuhandeln, zumindest fragwürdig. Denn es müsste zuerst empirisch überprüft werden, ob es sich um einen oder um zwei verschiedene Signifikanten handelt. Wenn es nämlich zwei wären, ginge es ja auch um zweiverschiedene Sprachzeichen.“
Das Problem, das hier - unter einem ...