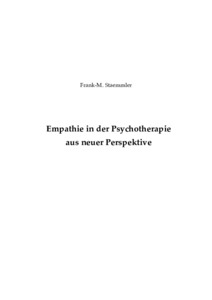Dissertation

Empathie in der Psychotherapie aus neuer Perspektive
Zusammenfassung
Die traditionellen Empathiekonzepte (z. B. Rogers, Kohut), die in der Psychotherapie bis heute
maßgebend sind, werden einer gründlichen Überprüfung unterzogen. Dabei ergeben sich drei
wesentliche Kritikpunkte: (1) Empathische Vorgänge in der Psychotherapie werden als einseitige
Prozesse verstanden; der Therapeut fühlt sich in die Klientin ein, nicht auch umgekehrt. (2) Empathie
wird in Cartesianischer Tradition schwerpunktmäßig als kognitive Leistung gesehen; ein körperloser
Geist vergegenwärtigt sich die mentalen Inhalte eines anderen. (3) Das traditionelle
Empathieverständnis ist individualistisch: Therapeutin und Klient halten sich demnach scheinbar im
luftleeren Raum auf. Es sieht so aus, als existiere kein Kontext, der sie umgibt. So einseitig, wie ihre
Beziehung gedacht wird, so abgetrennt, wie ihr Körper von ihrem Geist zu sein scheint, so
unverbunden sind sie scheinbar mit dem Rest der Welt.
Aus diesen drei Kritikpunkten folgt die Notwendigkeit, den Empathiebegriff der Psychotherapie
zu erweitern, d. h. (a) Empathie als gegenseitigen Prozess der Beteiligten zu begreifen, (b) ihre tiefe
Verwurzelung in der Leiblichkeit des Menschen zu berücksichtigen und (c) ihre Einbettung in die
Dynamiken einer gemeinsamen Situation im Rahmen eines kulturellen Kontextes einzubeziehen. Mit
Rückgriff auf neuere Untersuchungsergebnisse aus der Entwicklungspsychologie (z. B. Emde,
Hobson, Meltzoff, Stern, Trevarthen), der Sozial- und Emotionspsychologie (z. B. Chartrand, Ekman,
Goleman, Hatfield, Holodynski), der sozialen Neurowissenschaften (z. B. Damasio, Gallese, Iacoboni,
LeDoux, Rizzolatti), aber auch mit Hilfe der Erkenntnisse aus der klassischen (Husserl, Merleau-
Ponty, Edith Stein) und der Neuen Phänomenologie (Schmitz) sowie aus symbolischem
Interaktionismus (Mead) und aus der kulturhistorischen Schule (Vygotskij) werden diese drei bislang
wenig beleuchteten Dimensionen der Empathie betrachtet.
ad a) Die Gegenseitigkeit empathischer Vorgänge in der Psychotherapie wird anhand des
entwicklungspsychologischen Konzepts des social referencing erläutert und untersucht: Kleinkinder,
die in eine unbekannte bzw. unsichere Situation geraten (z. B. im Experiment mit der "visuellen
Klippe"), orientieren sich an den nonverbalen Signalen ihrer Bezugspersonen, um diese Situation zu
bewältigen. Dabei erfasst die Mutter die Situation des Kindes, versucht ihm ihre Stellungnahme zu
seiner Situation zu übermitteln, und das Kind begreift die Reaktion der Mutter als Stellungnahme zu
seiner Situation.
ad b) Die Körperlichkeit bzw. Leiblichkeit der Einfühlung manifestiert sich in vielfältigen Formen,
wie sie von der Psychologie, der Phänomenologie und den Neurowissenschaften erforscht werden.
Das kulturübergreifende Erkennen des Gesichtsausdrucks von Basisemotionen ist hier ebenso zu
nennen wie die Verhaltensweisen des motor mimicry, bei dem Menschen Körperhaltungen und –
bewegungen ihrer Bezugspersonen unwillkürlich imitieren; des Weiteren das unmittelbare Verstehen
von Gesten sowie die Phänomene der „Einleibung“, bei denen die körperliche Situation des Anderen
(z. B. eines stürzenden Radfahrers, den man beobachtet) am eigenen Leib mitgefühlt wird; und
außerdem die Entdeckung der „Spiegelneurone“ und anderer neuronaler Strukturen, durch die
Wahrgenommenes direkt in analoge motorische Aktivität übersetzt wird.
ad c) Intersubjektivitätstheoretische Überlegungen, Konzepte wie „dyadisch erweiterter
Bewusstseinszustand“ (Tronick) und „gemeinsame Situation“ (Gurwitsch, Schmitz) verweisen auf die
Bedeutung überindividueller, ‚emergenter’ Dimensionen, die für die Verständigung zwischen
Menschen wichtig sind. Sie folgen gestaltpsychologischen Prinzipien („Das Ganze ist mehr und
anders als die Summe seiner Teile.“), die mit Hilfe von Gadamers Begriff des „Spiels“ analysiert
werden.
Am Ende der Arbeit stehen die Definition eines neuen Empathiebegriffs, wie er sich aus den
vorangegangenen Überlegungen ergibt, sowie eine These über die psychotherapeutische Wirkweise
menschlicher Einfühlung, die durch weitere Forschungen zu überprüfen wäre.
maßgebend sind, werden einer gründlichen Überprüfung unterzogen. Dabei ergeben sich drei
wesentliche Kritikpunkte: (1) Empathische Vorgänge in der Psychotherapie werden als einseitige
Prozesse verstanden; der Therapeut fühlt sich in die Klientin ein, nicht auch umgekehrt. (2) Empathie
wird in Cartesianischer Tradition schwerpunktmäßig als kognitive Leistung gesehen; ein körperloser
Geist vergegenwärtigt sich die mentalen Inhalte eines anderen. (3) Das traditionelle
Empathieverständnis ist individualistisch: Therapeutin und Klient halten sich demnach scheinbar im
luftleeren Raum auf. Es sieht so aus, als existiere kein Kontext, der sie umgibt. So einseitig, wie ihre
Beziehung gedacht wird, so abgetrennt, wie ihr Körper von ihrem Geist zu sein scheint, so
unverbunden sind sie scheinbar mit dem Rest der Welt.
Aus diesen drei Kritikpunkten folgt die Notwendigkeit, den Empathiebegriff der Psychotherapie
zu erweitern, d. h. (a) Empathie als gegenseitigen Prozess der Beteiligten zu begreifen, (b) ihre tiefe
Verwurzelung in der Leiblichkeit des Menschen zu berücksichtigen und (c) ihre Einbettung in die
Dynamiken einer gemeinsamen Situation im Rahmen eines kulturellen Kontextes einzubeziehen. Mit
Rückgriff auf neuere Untersuchungsergebnisse aus der Entwicklungspsychologie (z. B. Emde,
Hobson, Meltzoff, Stern, Trevarthen), der Sozial- und Emotionspsychologie (z. B. Chartrand, Ekman,
Goleman, Hatfield, Holodynski), der sozialen Neurowissenschaften (z. B. Damasio, Gallese, Iacoboni,
LeDoux, Rizzolatti), aber auch mit Hilfe der Erkenntnisse aus der klassischen (Husserl, Merleau-
Ponty, Edith Stein) und der Neuen Phänomenologie (Schmitz) sowie aus symbolischem
Interaktionismus (Mead) und aus der kulturhistorischen Schule (Vygotskij) werden diese drei bislang
wenig beleuchteten Dimensionen der Empathie betrachtet.
ad a) Die Gegenseitigkeit empathischer Vorgänge in der Psychotherapie wird anhand des
entwicklungspsychologischen Konzepts des social referencing erläutert und untersucht: Kleinkinder,
die in eine unbekannte bzw. unsichere Situation geraten (z. B. im Experiment mit der "visuellen
Klippe"), orientieren sich an den nonverbalen Signalen ihrer Bezugspersonen, um diese Situation zu
bewältigen. Dabei erfasst die Mutter die Situation des Kindes, versucht ihm ihre Stellungnahme zu
seiner Situation zu übermitteln, und das Kind begreift die Reaktion der Mutter als Stellungnahme zu
seiner Situation.
ad b) Die Körperlichkeit bzw. Leiblichkeit der Einfühlung manifestiert sich in vielfältigen Formen,
wie sie von der Psychologie, der Phänomenologie und den Neurowissenschaften erforscht werden.
Das kulturübergreifende Erkennen des Gesichtsausdrucks von Basisemotionen ist hier ebenso zu
nennen wie die Verhaltensweisen des motor mimicry, bei dem Menschen Körperhaltungen und –
bewegungen ihrer Bezugspersonen unwillkürlich imitieren; des Weiteren das unmittelbare Verstehen
von Gesten sowie die Phänomene der „Einleibung“, bei denen die körperliche Situation des Anderen
(z. B. eines stürzenden Radfahrers, den man beobachtet) am eigenen Leib mitgefühlt wird; und
außerdem die Entdeckung der „Spiegelneurone“ und anderer neuronaler Strukturen, durch die
Wahrgenommenes direkt in analoge motorische Aktivität übersetzt wird.
ad c) Intersubjektivitätstheoretische Überlegungen, Konzepte wie „dyadisch erweiterter
Bewusstseinszustand“ (Tronick) und „gemeinsame Situation“ (Gurwitsch, Schmitz) verweisen auf die
Bedeutung überindividueller, ‚emergenter’ Dimensionen, die für die Verständigung zwischen
Menschen wichtig sind. Sie folgen gestaltpsychologischen Prinzipien („Das Ganze ist mehr und
anders als die Summe seiner Teile.“), die mit Hilfe von Gadamers Begriff des „Spiels“ analysiert
werden.
Am Ende der Arbeit stehen die Definition eines neuen Empathiebegriffs, wie er sich aus den
vorangegangenen Überlegungen ergibt, sowie eine These über die psychotherapeutische Wirkweise
menschlicher Einfühlung, die durch weitere Forschungen zu überprüfen wäre.
Traditional concepts of empathy (for instance, those described by Rogers or Kohut) that are still
standard in contemporary psychotherapy are thoroughly scrutinized. Three essential points of
criticism emerge: (1) Empathic processes in psychotherapy are understood as one-sided processes; the
therapist empathizes with the client, and not vice versa. (2) Following the Cartesian legacy, empathy is
basically regarded as a cognitive capacity: One body-less mind envisions the mental 'content' of
another. (3) The traditional notion of empathy is individualistic. Therapist and client are seemingly
situated in evacuated space; it looks as if there was no context surrounding them. — As one-sided as
their relationship is conceived of, as separated as their bodies seem to be from their minds, as isolated
the participants appear to be from the rest of the world.
From these three points of critique follows the necessity to enlarge the concept of empathy, i. e.
(a) to understand empathy as a mutual process between client and therapist, (b) to take into account its
profound rootedness in the embodiment of human existence, and (c) to embrace its embeddedness in
the dynamics of a joint situation within the framework of a given cultural context. The author
investigates these three dimensions of empathy, that have been neglected very much in the past, from
various points of view: He draws on developmental psychology (for instance, Emde, Hobson,
Meltzoff, Stern, Trevarthen), on social psychology and the study of emotions (for instance, Chartrand,
Ekman, Goleman, Hatfield, Holodynski), the social neurosciences (for instance, Damasio, Gallese,
Iacoboni, LeDoux, Rizzolatti). Insights from classical phenomenology (Husserl, Merleau-Ponty, Edith
Stein) and from Schmitz's "New Phenomenology" as well as from symbolic interactionism (Mead) and
from Vygotskij's cultural-historical theory are also used.
ad a) The mutuality of empathic processes in psychotherapy is illustrated by means of a concept
from developmental psychology called "social referencing": Infants who find themselves in an unknown
or insecure situation (for instance, the "visual cliff"), tend to orient themselves on the basis of the
nonverbal signals from their caregivers in order to cope with their situation. Typically the mother
comprehends the difficult situation of the child, tries to convey her appraisal of its situation to the
child, and the child adequately understands the reaction of the mother as a comment on its situation.
ad b) The embodiment of empathy can be demonstrated in numerous ways as has been explored
by psychological research, phenomenological philosophy, and modern neuroscience. For instance,
independent of their respective cultural affiliations human beings recognize the facial expressions of
the so called "basic emotions" in others; behavioral patterns called "motor mimicry", by which people
involuntarily imitate others' postures and movements, form another example; moreover, there is also
the phenomeon of immediate understanding of gestures, as well as the manifold phenomena of "embody-
pathy" (German: "Einleibung") in which the physical situation of another person is 'co-felt' (for
instance, the falling cyclist whom one watches); and finally the discovery of "mirror neurons" and
other neural structures that 'translate' visual information about the movements of the observed person
into analog subtle motor activity in the observer.
ad c) Theories of intersubjectivity, concepts such as "dyadically expanded states of consciousness"
(Tronick) and the "joint situation" (Gurwitsch, Schmitz) point to trans-individual 'emergent'
dimensions that are significant for empathic understanding among humans. They obey the principle
of gestalt psychology that the whole is more and different than the sum of its parts and they can also
be analyzed by means of Gadamer's notion of the "play."
All of these considerations are summed up in the definition of a new notion of empathy. In the
final chapter a thesis is proposed that might help to understand the therapeutic effects of human
empathy and that could be examined in future research.
standard in contemporary psychotherapy are thoroughly scrutinized. Three essential points of
criticism emerge: (1) Empathic processes in psychotherapy are understood as one-sided processes; the
therapist empathizes with the client, and not vice versa. (2) Following the Cartesian legacy, empathy is
basically regarded as a cognitive capacity: One body-less mind envisions the mental 'content' of
another. (3) The traditional notion of empathy is individualistic. Therapist and client are seemingly
situated in evacuated space; it looks as if there was no context surrounding them. — As one-sided as
their relationship is conceived of, as separated as their bodies seem to be from their minds, as isolated
the participants appear to be from the rest of the world.
From these three points of critique follows the necessity to enlarge the concept of empathy, i. e.
(a) to understand empathy as a mutual process between client and therapist, (b) to take into account its
profound rootedness in the embodiment of human existence, and (c) to embrace its embeddedness in
the dynamics of a joint situation within the framework of a given cultural context. The author
investigates these three dimensions of empathy, that have been neglected very much in the past, from
various points of view: He draws on developmental psychology (for instance, Emde, Hobson,
Meltzoff, Stern, Trevarthen), on social psychology and the study of emotions (for instance, Chartrand,
Ekman, Goleman, Hatfield, Holodynski), the social neurosciences (for instance, Damasio, Gallese,
Iacoboni, LeDoux, Rizzolatti). Insights from classical phenomenology (Husserl, Merleau-Ponty, Edith
Stein) and from Schmitz's "New Phenomenology" as well as from symbolic interactionism (Mead) and
from Vygotskij's cultural-historical theory are also used.
ad a) The mutuality of empathic processes in psychotherapy is illustrated by means of a concept
from developmental psychology called "social referencing": Infants who find themselves in an unknown
or insecure situation (for instance, the "visual cliff"), tend to orient themselves on the basis of the
nonverbal signals from their caregivers in order to cope with their situation. Typically the mother
comprehends the difficult situation of the child, tries to convey her appraisal of its situation to the
child, and the child adequately understands the reaction of the mother as a comment on its situation.
ad b) The embodiment of empathy can be demonstrated in numerous ways as has been explored
by psychological research, phenomenological philosophy, and modern neuroscience. For instance,
independent of their respective cultural affiliations human beings recognize the facial expressions of
the so called "basic emotions" in others; behavioral patterns called "motor mimicry", by which people
involuntarily imitate others' postures and movements, form another example; moreover, there is also
the phenomeon of immediate understanding of gestures, as well as the manifold phenomena of "embody-
pathy" (German: "Einleibung") in which the physical situation of another person is 'co-felt' (for
instance, the falling cyclist whom one watches); and finally the discovery of "mirror neurons" and
other neural structures that 'translate' visual information about the movements of the observed person
into analog subtle motor activity in the observer.
ad c) Theories of intersubjectivity, concepts such as "dyadically expanded states of consciousness"
(Tronick) and the "joint situation" (Gurwitsch, Schmitz) point to trans-individual 'emergent'
dimensions that are significant for empathic understanding among humans. They obey the principle
of gestalt psychology that the whole is more and different than the sum of its parts and they can also
be analyzed by means of Gadamer's notion of the "play."
All of these considerations are summed up in the definition of a new notion of empathy. In the
final chapter a thesis is proposed that might help to understand the therapeutic effects of human
empathy and that could be examined in future research.
Zitieren
@phdthesis{urn:nbn:de:hebis:34-2009022526404,
author={Staemmler, Frank-M.},
title={Empathie in der Psychotherapie aus neuer Perspektive},
school={Kassel, Universität, FB 01, Erziehungswissenschaft, Humanwissenschaften},
month={02},
year={2009}
}
0500 Oax
0501 Text $btxt$2rdacontent
0502 Computermedien $bc$2rdacarrier
1100 2009$n2009
1500 1/ger
2050 ##0##urn:nbn:de:hebis:34-2009022526404
3000 Staemmler, Frank-M.
4000 Empathie in der Psychotherapie aus neuer Perspektive / Staemmler, Frank-M.
4030
4060 Online-Ressource
4085 ##0##=u http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:hebis:34-2009022526404=x R
4204 \$dDissertation
4170
5550 {{Einfühlung}}
5550 {{Psychotherapie}}
5550 {{Intersubjektivität}}
5550 {{Leiblichkeit}}
5550 {{Gestalttherapie}}
7136 ##0##urn:nbn:de:hebis:34-2009022526404
<resource xsi:schemaLocation="http://datacite.org/schema/kernel-2.2 http://schema.datacite.org/meta/kernel-2.2/metadata.xsd"> 2009-02-25T09:57:00Z 2009-02-25T09:57:00Z 2009-02-25T09:57:00Z urn:nbn:de:hebis:34-2009022526404 http://hdl.handle.net/123456789/2009022526404 2188139 bytes application/pdf ger Urheberrechtlich geschützt https://rightsstatements.org/page/InC/1.0/ Empathie Situation, gemeinsame 150 Empathie in der Psychotherapie aus neuer Perspektive Dissertation Die traditionellen Empathiekonzepte (z. B. Rogers, Kohut), die in der Psychotherapie bis heute maßgebend sind, werden einer gründlichen Überprüfung unterzogen. Dabei ergeben sich drei wesentliche Kritikpunkte: (1) Empathische Vorgänge in der Psychotherapie werden als einseitige Prozesse verstanden; der Therapeut fühlt sich in die Klientin ein, nicht auch umgekehrt. (2) Empathie wird in Cartesianischer Tradition schwerpunktmäßig als kognitive Leistung gesehen; ein körperloser Geist vergegenwärtigt sich die mentalen Inhalte eines anderen. (3) Das traditionelle Empathieverständnis ist individualistisch: Therapeutin und Klient halten sich demnach scheinbar im luftleeren Raum auf. Es sieht so aus, als existiere kein Kontext, der sie umgibt. So einseitig, wie ihre Beziehung gedacht wird, so abgetrennt, wie ihr Körper von ihrem Geist zu sein scheint, so unverbunden sind sie scheinbar mit dem Rest der Welt. Aus diesen drei Kritikpunkten folgt die Notwendigkeit, den Empathiebegriff der Psychotherapie zu erweitern, d. h. (a) Empathie als gegenseitigen Prozess der Beteiligten zu begreifen, (b) ihre tiefe Verwurzelung in der Leiblichkeit des Menschen zu berücksichtigen und (c) ihre Einbettung in die Dynamiken einer gemeinsamen Situation im Rahmen eines kulturellen Kontextes einzubeziehen. Mit Rückgriff auf neuere Untersuchungsergebnisse aus der Entwicklungspsychologie (z. B. Emde, Hobson, Meltzoff, Stern, Trevarthen), der Sozial- und Emotionspsychologie (z. B. Chartrand, Ekman, Goleman, Hatfield, Holodynski), der sozialen Neurowissenschaften (z. B. Damasio, Gallese, Iacoboni, LeDoux, Rizzolatti), aber auch mit Hilfe der Erkenntnisse aus der klassischen (Husserl, Merleau- Ponty, Edith Stein) und der Neuen Phänomenologie (Schmitz) sowie aus symbolischem Interaktionismus (Mead) und aus der kulturhistorischen Schule (Vygotskij) werden diese drei bislang wenig beleuchteten Dimensionen der Empathie betrachtet. ad a) Die Gegenseitigkeit empathischer Vorgänge in der Psychotherapie wird anhand des entwicklungspsychologischen Konzepts des social referencing erläutert und untersucht: Kleinkinder, die in eine unbekannte bzw. unsichere Situation geraten (z. B. im Experiment mit der "visuellen Klippe"), orientieren sich an den nonverbalen Signalen ihrer Bezugspersonen, um diese Situation zu bewältigen. Dabei erfasst die Mutter die Situation des Kindes, versucht ihm ihre Stellungnahme zu seiner Situation zu übermitteln, und das Kind begreift die Reaktion der Mutter als Stellungnahme zu seiner Situation. ad b) Die Körperlichkeit bzw. Leiblichkeit der Einfühlung manifestiert sich in vielfältigen Formen, wie sie von der Psychologie, der Phänomenologie und den Neurowissenschaften erforscht werden. Das kulturübergreifende Erkennen des Gesichtsausdrucks von Basisemotionen ist hier ebenso zu nennen wie die Verhaltensweisen des motor mimicry, bei dem Menschen Körperhaltungen und – bewegungen ihrer Bezugspersonen unwillkürlich imitieren; des Weiteren das unmittelbare Verstehen von Gesten sowie die Phänomene der „Einleibung“, bei denen die körperliche Situation des Anderen (z. B. eines stürzenden Radfahrers, den man beobachtet) am eigenen Leib mitgefühlt wird; und außerdem die Entdeckung der „Spiegelneurone“ und anderer neuronaler Strukturen, durch die Wahrgenommenes direkt in analoge motorische Aktivität übersetzt wird. ad c) Intersubjektivitätstheoretische Überlegungen, Konzepte wie „dyadisch erweiterter Bewusstseinszustand“ (Tronick) und „gemeinsame Situation“ (Gurwitsch, Schmitz) verweisen auf die Bedeutung überindividueller, ‚emergenter’ Dimensionen, die für die Verständigung zwischen Menschen wichtig sind. Sie folgen gestaltpsychologischen Prinzipien („Das Ganze ist mehr und anders als die Summe seiner Teile.“), die mit Hilfe von Gadamers Begriff des „Spiels“ analysiert werden. Am Ende der Arbeit stehen die Definition eines neuen Empathiebegriffs, wie er sich aus den vorangegangenen Überlegungen ergibt, sowie eine These über die psychotherapeutische Wirkweise menschlicher Einfühlung, die durch weitere Forschungen zu überprüfen wäre. Traditional concepts of empathy (for instance, those described by Rogers or Kohut) that are still standard in contemporary psychotherapy are thoroughly scrutinized. Three essential points of criticism emerge: (1) Empathic processes in psychotherapy are understood as one-sided processes; the therapist empathizes with the client, and not vice versa. (2) Following the Cartesian legacy, empathy is basically regarded as a cognitive capacity: One body-less mind envisions the mental 'content' of another. (3) The traditional notion of empathy is individualistic. Therapist and client are seemingly situated in evacuated space; it looks as if there was no context surrounding them. — As one-sided as their relationship is conceived of, as separated as their bodies seem to be from their minds, as isolated the participants appear to be from the rest of the world. From these three points of critique follows the necessity to enlarge the concept of empathy, i. e. (a) to understand empathy as a mutual process between client and therapist, (b) to take into account its profound rootedness in the embodiment of human existence, and (c) to embrace its embeddedness in the dynamics of a joint situation within the framework of a given cultural context. The author investigates these three dimensions of empathy, that have been neglected very much in the past, from various points of view: He draws on developmental psychology (for instance, Emde, Hobson, Meltzoff, Stern, Trevarthen), on social psychology and the study of emotions (for instance, Chartrand, Ekman, Goleman, Hatfield, Holodynski), the social neurosciences (for instance, Damasio, Gallese, Iacoboni, LeDoux, Rizzolatti). Insights from classical phenomenology (Husserl, Merleau-Ponty, Edith Stein) and from Schmitz's "New Phenomenology" as well as from symbolic interactionism (Mead) and from Vygotskij's cultural-historical theory are also used. ad a) The mutuality of empathic processes in psychotherapy is illustrated by means of a concept from developmental psychology called "social referencing": Infants who find themselves in an unknown or insecure situation (for instance, the "visual cliff"), tend to orient themselves on the basis of the nonverbal signals from their caregivers in order to cope with their situation. Typically the mother comprehends the difficult situation of the child, tries to convey her appraisal of its situation to the child, and the child adequately understands the reaction of the mother as a comment on its situation. ad b) The embodiment of empathy can be demonstrated in numerous ways as has been explored by psychological research, phenomenological philosophy, and modern neuroscience. For instance, independent of their respective cultural affiliations human beings recognize the facial expressions of the so called "basic emotions" in others; behavioral patterns called "motor mimicry", by which people involuntarily imitate others' postures and movements, form another example; moreover, there is also the phenomeon of immediate understanding of gestures, as well as the manifold phenomena of "embody- pathy" (German: "Einleibung") in which the physical situation of another person is 'co-felt' (for instance, the falling cyclist whom one watches); and finally the discovery of "mirror neurons" and other neural structures that 'translate' visual information about the movements of the observed person into analog subtle motor activity in the observer. ad c) Theories of intersubjectivity, concepts such as "dyadically expanded states of consciousness" (Tronick) and the "joint situation" (Gurwitsch, Schmitz) point to trans-individual 'emergent' dimensions that are significant for empathic understanding among humans. They obey the principle of gestalt psychology that the whole is more and different than the sum of its parts and they can also be analyzed by means of Gadamer's notion of the "play." All of these considerations are summed up in the definition of a new notion of empathy. In the final chapter a thesis is proposed that might help to understand the therapeutic effects of human empathy and that could be examined in future research. open access Staemmler, Frank-M. Kassel, Universität, FB 01, Erziehungswissenschaft, Humanwissenschaften Burow, Olaf-Axel (Prof. Dr.) Ludwig, Peter H. (Prof. Dr.) Eine erweiterte Druckausgabe ist unter dem Titel "Das Geheimnis des Anderen — Empathie in der Psychotherapie: wie Therapeuten und Klienten einander verstehen" im Verlag Klett-Cotta, Stuttgart (ISBN 978-3-608-94503-4) erschienen. Einfühlung Psychotherapie Intersubjektivität Leiblichkeit Gestalttherapie 2009-01-28 </resource>
Die folgenden Lizenzbestimmungen sind mit dieser Ressource verbunden:
Urheberrechtlich geschützt